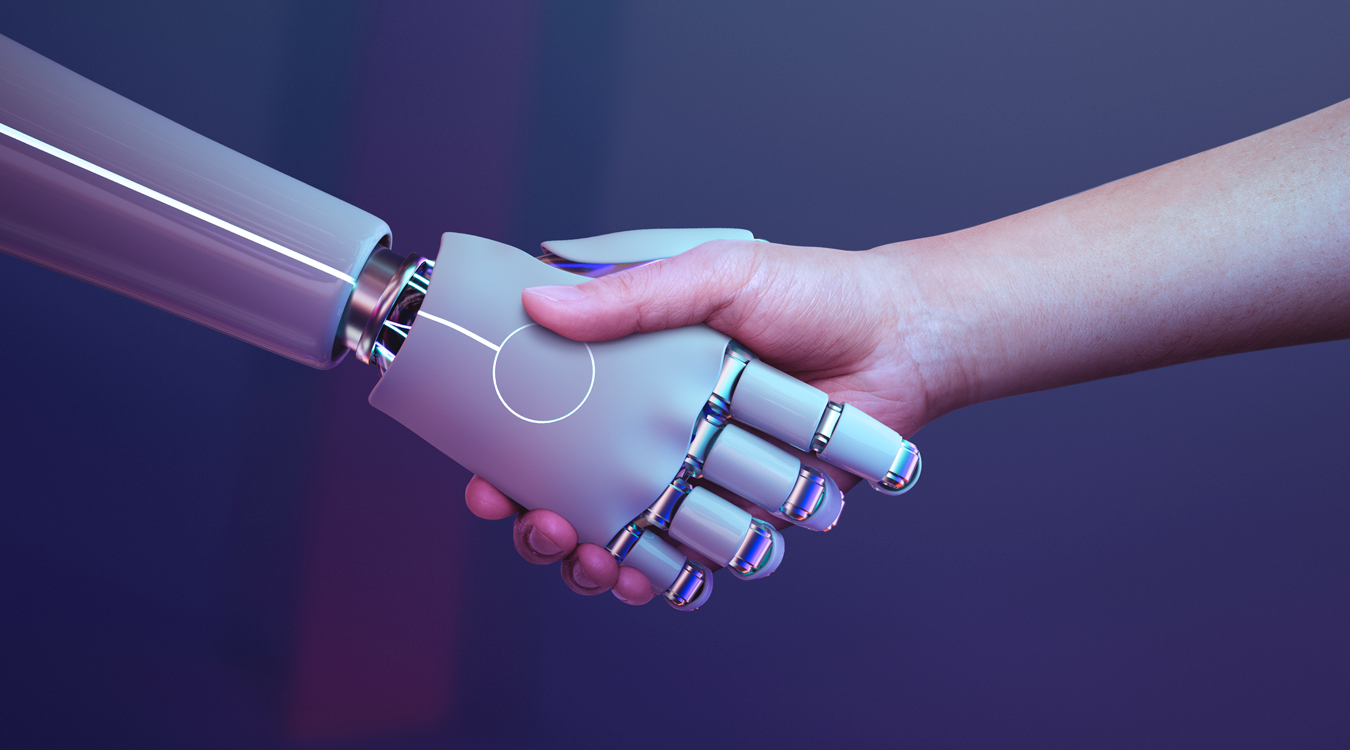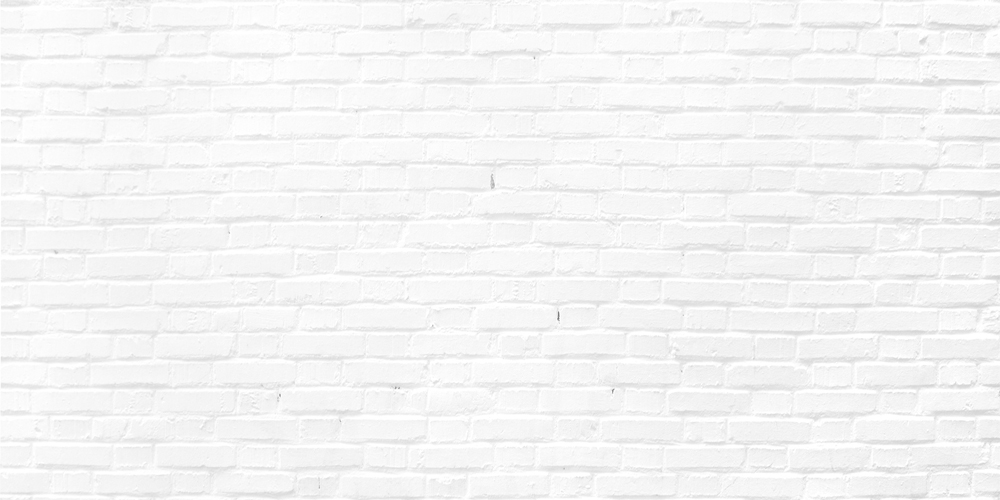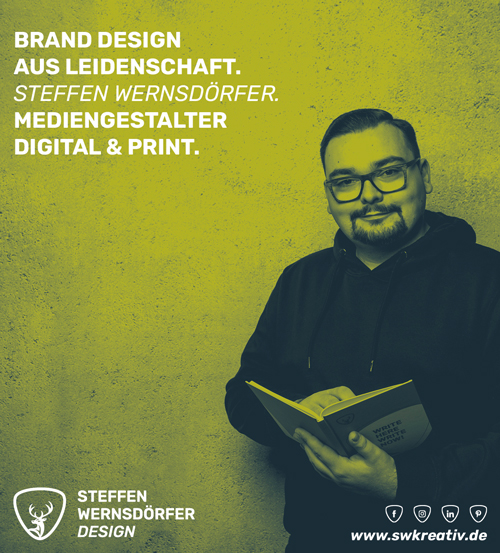In der anstehenden Abschlussprüfung für Mediengestalter Digital und Print im Sommer 2025 ist im Bereich Konzeption und Gestaltung eine Frage zum Thema Kostenarten enthalten. Ein zentrales Thema dabei ist das Verständnis verschiedener Kostenarten und deren Bedeutung für die Kalkulation und Preisgestaltung in der Medienbranche. Dieser Blogbeitrag bietet dir eine ausführliche Übersicht über die wichtigsten Kostenarten, ihre Einteilungen und konkrete Anwendungsbeispiele aus der Mediengestaltung.
1. Grundlegende Kostenbegriffe und -definitionen
Bevor wir in die spezifischen Kostenarten eintauchen, sollten wir einige grundlegende Begriffe klären:
Kosten sind der bewertete Verbrauch von Produktionsfaktoren (Güter, Dienstleistungen, Arbeit) zur Erstellung betrieblicher Leistungen in einer bestimmten Periode. Sie sind von Ausgaben zu unterscheiden, die reine Geldabflüsse darstellen.
Aufwendungen sind die in der Finanzbuchhaltung erfassten Wertminderungen. Sie sind nicht immer identisch mit Kosten.
Beispiel:
- Ein Mediengestalter verwendet eine professionelle Kamera für ein Fotoshooting (= Kosten)
- Die Abschreibung der Kamera wird als Aufwand in der Buchhaltung erfasst
2. Einteilung nach der Zurechenbarkeit: Einzelkosten und Gemeinkosten
2.1 Einzelkosten
Einzelkosten (auch direkte Kosten genannt) können einem Kostenträger (Produkt, Dienstleistung oder Auftrag) direkt zugerechnet werden.
Beispiele aus der Mediengestaltung:
- Papierkosten für einen Druckauftrag
- Lizenzen für Stockfotos für einen bestimmten Kunden
- Spezielle Farben für einen Druckauftrag
- Arbeitszeit eines Grafikdesigners für ein bestimmtes Projekt
Konkrete Berechnung: Ein Kunde bestellt 1.000 Broschüren. Der Papierverbrauch pro Broschüre beträgt 0,25 € und die Druckfarbe 0,10 € pro Stück. Die Einzelkosten für Material betragen somit: 1.000 × (0,25 € + 0,10 €) = 350 €.
2.2 Gemeinkosten
Gemeinkosten (auch indirekte Kosten genannt) können nicht unmittelbar einem bestimmten Kostenträger zugerechnet werden, sondern fallen für mehrere Produkte oder Dienstleistungen gemeinsam an.
Beispiele aus der Mediengestaltung:
- Miete für das Designstudio
- Stromkosten für die Beleuchtung und die Computer
- Gehalt des Geschäftsführers
- Kosten für Designsoftware-Abonnements (Adobe Creative Cloud)
- Versicherungen für die Betriebsausstattung
Konkrete Berechnung: Ein Designstudio hat monatliche Gemeinkosten von 8.000 € und arbeitet durchschnittlich an 20 Projekten pro Monat. Durch einen Gemeinkostenzuschlagsatz werden jedem Projekt pauschal 400 € (8.000 € ÷ 20) an Gemeinkosten zugerechnet.
3. Einteilung nach der Abhängigkeit vom Beschäftigungsgrad: Fixe und variable Kosten
3.1 Fixe Kosten
Fixe Kosten bleiben in ihrer Höhe konstant, unabhängig davon, wie viele Aufträge bearbeitet oder Produkte hergestellt werden.
Beispiele aus der Mediengestaltung:
- Miete für Büroräume
- Grundgebühren für Internet und Telefon
- Abschreibungen für Geräte (Computer, Drucker, Kameras)
- Gehälter für festangestellte Mitarbeiter
- Leasingraten für Geräte
Besondere Eigenschaften:
- Die fixen Kosten pro Stück (Stückfixkosten) sinken mit steigender Produktionsmenge
- Formel: Stückfixkosten = Fixe Kosten ÷ Produktionsmenge
Beispielrechnung: Ein Designstudio hat monatliche fixe Kosten von 6.000 €. Bei 10 Projekten im Monat betragen die Fixkosten pro Projekt 600 €. Steigt die Anzahl auf 15 Projekte, sinken die Fixkosten pro Projekt auf 400 €.
3.2 Variable Kosten
Variable Kosten verändern sich mit der Produktionsmenge oder der Anzahl der bearbeiteten Aufträge.
Beispiele aus der Mediengestaltung:
- Materialkosten (Papier, Druckfarbe)
- Honorare für freie Mitarbeiter
- Stromkosten für den Betrieb von Druckmaschinen
- Lizenzgebühren für Stockfotos pro Projekt
- Versandkosten für fertige Druckerzeugnisse
Unterscheidung nach Verhalten:
- Proportional variable Kosten: steigen im gleichen Verhältnis wie die Produktionsmenge (z.B. Papierkosten)
- Degressiv variable Kosten: steigen unterproportional zur Produktionsmenge (z.B. Mengenrabatte bei Einkauf großer Papiermengen)
- Progressiv variable Kosten: steigen überproportional zur Produktionsmenge (z.B. Überstundenzuschläge bei hoher Auslastung)
Beispielrechnung: Ein Druckauftrag verursacht folgende variable Kosten pro Stück:
- Papier: 0,20 €
- Farbe: 0,15 €
- Verarbeitung: 0,25 €
Bei 100 Exemplaren: 100 × (0,20 € + 0,15 € + 0,25 €) = 60 € Bei 1.000 Exemplaren: 1.000 × (0,20 € + 0,15 € + 0,25 €) = 600 €
4. Einteilung nach der Herkunft: Primäre und sekundäre Kosten
4.1 Primäre Kosten
Primäre Kosten entstehen durch den Verbrauch von Produktionsfaktoren, die von außerhalb des Unternehmens bezogen werden.
Beispiele aus der Mediengestaltung:
- Materialkosten (Papier, Druckfarben)
- Stromkosten
- Gehälter und Löhne
- Mieten
- Kosten für externe Dienstleistungen (z.B. Fotografen)
4.2 Sekundäre Kosten
Sekundäre Kosten entstehen durch die innerbetriebliche Leistungsverrechnung zwischen verschiedenen Kostenstellen.
Beispiele aus der Mediengestaltung:
- Interne IT-Leistungen für die Designabteilung
- Kosten der hauseigenen Druckerei für die Marketingabteilung
- Entwicklung eines Logos durch die Designabteilung für die eigene Werbeabteilung
5. Einteilung nach betriebswirtschaftlicher Bedeutung
5.1 Leistungskosten
Leistungskosten sind Kosten, die unmittelbar mit der Erstellung der betrieblichen Leistung zusammenhängen.
Beispiele aus der Mediengestaltung:
- Materialkosten für Druckprodukte
- Gehälter der Designer
- Abschreibungen auf Designsoftware
5.2 Bereitschaftskosten
Bereitschaftskosten fallen für die Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft an, unabhängig von der tatsächlichen Leistungserstellung.
Beispiele aus der Mediengestaltung:
- Miete für das Studio
- Grundversorgung mit Strom, Wasser, Heizung
- Gehälter des Verwaltungspersonals
6. Kostenstellenrechnung in der Mediengestaltung
In größeren Medienbetrieben werden Kosten oft nach Kostenstellen gegliedert, um die Verantwortlichkeiten klar zuzuordnen.
Typische Kostenstellen in einem Medienunternehmen:
- Design/Kreation
- Produktion/Druck
- IT/Technik
- Verwaltung
- Vertrieb/Marketing
Beispiel für Gemeinkostenverteilung: Die monatlichen Mietkosten von 5.000 € werden nach der genutzten Fläche auf die Kostenstellen verteilt:
- Design (100 m²): 2.000 €
- Produktion (75 m²): 1.500 €
- Verwaltung (50 m²): 1.000 €
- Vertrieb (25 m²): 500 €
7. Praxisbeispiel: Vollkostenkalkulation eines Druckauftrags
Aufgabe:
Ein Kunde bestellt 1.000 Imagebroschüren (16 Seiten, Vierfarbdruck). Kalkuliere den Preis auf Vollkostenbasis mit einem Gewinnzuschlag von 15%.
Kostenermittlung:
Einzelkosten:
- Papier: 1.000 St. × 0,50 € = 500 €
- Druckfarbe: 1.000 St. × 0,30 € = 300 €
- Bindung: 1.000 St. × 0,20 € = 200 €
- Designerarbeitszeit: 15 Std. × 50 € = 750 €
- Summe Einzelkosten: 1.750 €
Gemeinkosten:
- Materialgemeinkostenzuschlag: 30% auf Materialeinzelkosten (500 € + 300 € + 200 €) = 300 €
- Fertigungsgemeinkostenzuschlag: 80% auf Fertigungseinzelkosten (750 €) = 600 €
- Verwaltungsgemeinkostenzuschlag: 15% auf Herstellkosten (1.750 € + 300 € + 600 €) = 397,50 €
- Vertriebsgemeinkostenzuschlag: 10% auf Herstellkosten = 265 €
- Summe Gemeinkosten: 1.562,50 €
Selbstkosten: 3.312,50 €
Gewinnzuschlag: 15% × 3.312,50 € = 496,88 €
Verkaufspreis: 3.809,38 € (ohne MwSt.)
Stückpreis: 3,81 € pro Broschüre
8. Break-Even-Analyse in der Mediengestaltung
Die Break-Even-Analyse ist ein wichtiges Instrument, um zu ermitteln, ab welcher Menge oder welchem Umsatz ein Produkt oder eine Dienstleistung die Kosten deckt und Gewinn abwirft.
Formel: Break-Even-Menge = Fixkosten ÷ (Preis pro Einheit – Variable Kosten pro Einheit)
Beispiel: Eine Druckerei hat jährliche Fixkosten von 120.000 €. Der Verkaufspreis pro Druckauftrag beträgt durchschnittlich 500 €, die variablen Kosten pro Auftrag liegen bei 300 €.
Break-Even-Menge = 120.000 € ÷ (500 € – 300 €) = 600 Aufträge
Die Druckerei muss also 600 Aufträge pro Jahr bearbeiten, um die Gewinnschwelle zu erreichen.
9. Kostenträgerrechnung: Kalkulation verschiedener Medienprodukte
Die Kostenträgerrechnung ordnet die Kosten den einzelnen Produkten oder Dienstleistungen zu.
9.1 Kalkulation einer Website
Einzelkosten:
- Konzeption: 8 Std. × 60 € = 480 €
- Design: 16 Std. × 60 € = 960 €
- Programmierung: 24 Std. × 65 € = 1.560 €
- Domain/Hosting (1 Jahr): 120 €
- CMS-Lizenz: 200 €
- Summe Einzelkosten: 3.320 €
Gemeinkosten:
- 70% Zuschlag auf Personalkosten = 2.100 €
Selbstkosten: 5.420 €
9.2 Kalkulation eines Logos
Einzelkosten:
- Recherche: 3 Std. × 60 € = 180 €
- Entwürfe: 8 Std. × 60 € = 480 €
- Finalisierung: 4 Std. × 60 € = 240 €
- Lizenzkosten für Schriften: 80 €
- Summe Einzelkosten: 980 €
Gemeinkosten:
- 70% Zuschlag auf Personalkosten = 630 €
Selbstkosten: 1.610 €
10. Digitalisierung und ihre Auswirkungen auf die Kostenstruktur
Die Digitalisierung hat die Kostenstruktur in der Medienbranche stark verändert:
10.1 Verschiebung von variablen zu fixen Kosten
- Früher: Hohe variable Kosten für Druckmaterialien
- Heute: Hohe Fixkosten für Software-Abonnements, Server, IT-Infrastruktur
10.2 Neue Kostenarten
- Cloud-Services
- Software-as-a-Service (SaaS)
- Online-Marketing
- Content-Management-Systeme
10.3 Beispiel: Kostenvergleich Print vs. Digital
Printanzeige:
- Design: 300 €
- Druckkosten: 2.000 €
- Verteilung: 1.500 €
- Gesamtkosten: 3.800 €
Digitale Anzeigenkampagne:
- Design: 300 €
- Online-Plattformgebühren: 500 €
- Analytics-Tool: 200 €
- Gesamtkosten: 1.000 €
11. Kostenoptimierung in der Mediengestaltung
11.1 Strategien zur Kostenreduktion
- Automatisierung von Routine-Aufgaben
- Einsatz von Templates und Vorlagen
- Outsourcing von Spezialtätigkeiten
- Verwendung von Open-Source-Software wo möglich
- Just-in-time-Produktion bei Druckerzeugnissen
11.2 Beispiel: Kostensenkung durch Workflow-Optimierung
Alter Workflow für einen Katalog:
- Konzeption: 20 Std. × 60 € = 1.200 €
- Design von Grund auf: 40 Std. × 60 € = 2.400 €
- Texterfassung: 15 Std. × 50 € = 750 €
- Bildbearbeitung: 25 Std. × 55 € = 1.375 €
- Layout: 30 Std. × 60 € = 1.800 € Gesamtkosten: 7.525 €
Optimierter Workflow:
- Konzeption: 15 Std. × 60 € = 900 €
- Design basierend auf Template: 20 Std. × 60 € = 1.200 €
- Texterfassung mit KI-Unterstützung: 8 Std. × 50 € = 400 €
- Automatisierte Bildbearbeitung: 10 Std. × 55 € = 550 €
- Layout mit Datenbank-Publishing: 15 Std. × 60 € = 900 € Gesamtkosten: 3.950 €
Einsparung: 3.575 € (47,5%)
12. Zusammenfassung der wichtigsten Kostenarten für die IHK-Prüfung
12.1 Nach Zurechenbarkeit
- Einzelkosten: direkt zurechenbar (Material, Arbeitsstunden)
- Gemeinkosten: nicht direkt zurechenbar (Miete, Verwaltung)
12.2 Nach Beschäftigungsgrad
- Fixe Kosten: unabhängig von der Produktionsmenge (Miete, Software-Lizenzen)
- Variable Kosten: abhängig von der Produktionsmenge (Material, Freiberufler)
12.3 Nach Herkunft
- Primäre Kosten: extern bezogene Faktoren (Material, Strom)
- Sekundäre Kosten: innerbetriebliche Verrechnung (IT-Services)
12.4 Nach betriebswirtschaftlicher Bedeutung
- Leistungskosten: direkt mit der Leistungserstellung verbunden
- Bereitschaftskosten: für die Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft
13. Übungsaufgaben für die IHK-Prüfungsvorbereitung
Aufgabe 1:
Eine Werbeagentur hat folgende monatliche Kosten:
- Miete: 3.000 €
- Gehälter (fest): 15.000 €
- Software-Lizenzen: 1.200 €
- Materialkosten: 0,50 € pro Auftrag
- Freie Mitarbeiter: 40 € pro Stunde
- Strom, Wasser, Internet: 800 €
Ordne diese Kosten den entsprechenden Kategorien zu (fix/variabel, Einzel-/Gemeinkosten).
Aufgabe 2:
Ein Mediengestalter kalkuliert einen Auftrag für ein Magazin-Layout. Die folgenden Kosten fallen an:
- Arbeitszeit: 25 Stunden à 60 € = 1.500 €
- Stockfotos: 200 €
- Anteilige Gemeinkosten: 60% der Personalkosten
Berechne die Selbstkosten und den Verkaufspreis bei einem Gewinnzuschlag von 20%.
Aufgabe 3:
Eine Druckerei hat jährliche Fixkosten von 250.000 € und variable Kosten von 30 € pro Druckauftrag. Der durchschnittliche Verkaufspreis beträgt 80 € pro Auftrag.
a) Berechne die Break-Even-Menge. b) Wie hoch ist der Gewinn bei 6.000 Aufträgen? c) Wie verändert sich die Break-Even-Menge, wenn der Verkaufspreis auf 70 € sinkt?
14. Fazit
Das Verständnis der verschiedenen Kostenarten und ihrer Zusammenhänge ist für angehende Mediengestalter von großer Bedeutung. Es bildet die Grundlage für fundierte betriebswirtschaftliche Entscheidungen, realistische Kalkulationen und erfolgreiche Projektplanungen. In der IHK-Prüfung wird dieses Wissen sowohl in Multiple-Choice-Fragen als auch in praxisnahen Fallstudien abgefragt.
Besonders wichtig ist es, die Unterschiede zwischen fixen und variablen Kosten sowie zwischen Einzel- und Gemeinkosten sicher zu beherrschen und diese Konzepte auf konkrete Fälle aus der Medienpraxis anwenden zu können. Durch die regelmäßige Übung von Kalkulationsaufgaben und die Auseinandersetzung mit realistischen Fallbeispielen kannst du dich optimal auf diesen Prüfungsteil vorbereiten.
Denke daran: Eine solide Kalkulation ist nicht nur für die Prüfung relevant, sondern wird dich durch dein gesamtes Berufsleben begleiten – sei es als Angestellter, der Projekte planen muss, oder später vielleicht als Selbstständiger, der eigene Angebote erstellt.